Einzellinsenauge bei wirbellosen Tieren
(Invertebraten)
Allgemein
- Die Funktionsweise ähnelt dem Linsenauge bei
Wirbeltieren stark, obwohl sich beide Augentypen phylogenetisch (Phylogenie = Lehre von der
Stammesentwicklung der Tiere und Pflanzen) unabhängig
voneinander entwickelt haben
- Einzellinsenaugen treten bei folgenden
wirbellosen Tieren auf:
- Weichtieren (Molluska)
- den meisten Cephalopoden (Kopffüßern, z.B. Kraken, Tintenfische)
- zum Stamm der Anneliden (Ringelwürmer)
gehörenden Polychaeten (Vielborster)
- Nesseltieren (Cnidaria, z.B Quallen und Medusen als Lebensstadien von
Nesseltieren)
(Lubjuhn 2005)
...im Vergleich zum Linsenauge bei
Wirbeltieren
Bei
den Augen der wirbellosen Tiere (Invertebraten)
handelt es sich um leistungsfähige Linsenaugen, die ähnlich den
Linsenaugen von Wirbeltieren aufgebaut sind. So verfügen sie beispielsweise
ebenfalls über Iris, Pupille und Linse; jedoch gibt es auch deutliche
Unterschiede zu den Augen der Wirbeltiere:
- die Lichtsinneszellen der Netzhaut (Retina) sind bei wirbellosen Tieren dem Lichteinfall zugewandt (→everses Auge); das Licht muss also nicht wie bei den Wirbeltieren zuerst mehrere Zellschichten durchdringen, bevor es auf die Netzhaut trifft (→inverses Auge)
- das Auge eines wirbellosen Tieres entsteht (anders als bei Wirbeltieren) durch eine Einfaltung der Epidermis, der embryonalen Außenhaut; dann wird dieser „Augenbecher“ vom Gehirn mit Nerven versorgt, weshalb die Sinneszellen nach außen zeigen
- ganz allgemein sind die Linsenaugen von wirbellosen Tieren phylogenetisch unabhängig von den Linsenaugen der Wirbeltiere entstanden; trotz gleicher Funktionsweise (siehe oben)
(Nordsiek
2005)
Vergleich der Retina von
Wirbeltieren und Wirbellosen Tieren:
Während der
Ontogenese* eines Menschen, also
dem Heranwachsen im Mutterleib, bilden sich die Augen aus einer Ausstülpung der
Zellen, die später zum Gehirn werden. Dies ist bei allen Wirbeltieren, zu denen
der Mensch ebenfalls gehört, gleich.
Bei den
Wirbellosentieren hingegen, werden die Augen während der Ontogenese* aus
der Einstülpung der embryonalen Epidermis gebildet. Sie gehen also aus der
äußersten Hautschicht hervor. (vgl. Lubjuhn 2005)
Daraus folgt ein
unterschiedlicher Aufbau der Netzhaut.
Bei Wirbellosentieren sind die Sehzellen der Retina dem Licht zugewandt (vgl. rote Schicht Abb. 1), dahinter liegt eine dünne Gewebsschicht, die hauptsächlich aus Nervenzellen besteht (grüne Schicht Abb. 1) Diesen Aufbau nennt man everse Retina.
Bei Wirbeltieren
durchdringt das Licht dagegen erst durch eine Gewebsschicht verschiedener
Nervenzellen (grüne Schicht in Abb. 2) bevor es die lichtempfindlichen
Sehzellen erreicht. Die Sehzellen der Retina (rote Schicht in Abb. 2) sind
dementsprechend dem Licht abgewandt. Diesen Aufbau bei Wirbeltieren
nennt man inverse Retina.
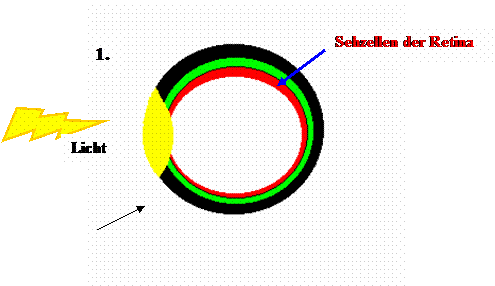
Abb. 1: Aufbau eines Wirbellosenauges mit everser Retina, die Sehzellen (rote Schicht) sind dem Licht zugewandt, die dünne Gewebsschicht aus Nervenzellen (grün) liegt dahinter; Ader- und Lederhaut sind schwarz; Linse, Iris, Augenkammern und Hornhaut sind gelb (aus Lubjuhn 2005 verändert)
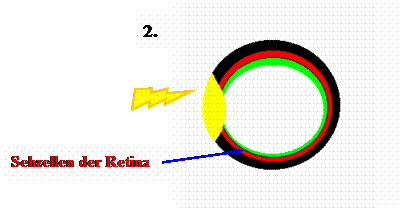
Abb. 2: Aufbau eines Wirbeltierauges mit inverser Retina, die Sehzellen (rote Schicht) sind dem Licht abgewandt, die dünne Gewebsschicht aus Nervenzellen (grün) liegt davor. (aus Lubjuhn 2005 verändert)
*Ontogenese
in der Biologie
Unter der Ontogenese versteht man in der Biologie die
Individualentwicklung, also die Entwicklung des einzelnen Lebewesens von der
befruchteten Eizelle zum erwachsenen Lebewesen. Dabei entwickeln sich beim
Embryo nach und nach Organanlagen, aus denen Organe entstehen, in denen
wiederum die Zellen (zu Geweben zusammengefasst) sich weiter spezialisieren.
(DocCheck 2002)
Phylogenese:
-
Griechisch phyle:
Stamm und genesis: Entstehung
-
Bezeichnung für die stammesgeschichtliche Entwicklung
von Lebewesen
-
Gibt Auskunft über die verwandtschaftlichen
Verhältnisse innerhalb einer bestimmten Gruppe von Lebewesen
-
Um die phylogenetische Entwicklung von Arten, Gattungen
oder Klassen zu rekonstruieren, werden erblich bedingte Eigenschaften lebender
Arten oder Fossilien untersucht.
- Das Ergebnis einer solchen Rekonstruktion lässt sich in Form eines Stammbaums beschreiben
Phylogenetisch:
Die Stammesgeschichte betreffend
Augenentwicklung:
Obwohl sich die Augen von Wirbeltieren und Weichtieren im Aufbau stark ähneln, haben sie sich unabhängig voneinander entwickelt. Es gibt Schätzungen, dass Augen der verschiedensten Bauweisen im Laufe der Evolution etwa 40 Mal neu entwickelt wurden. Die ersten Augen gab es bereits vor 505 Mio. Jahren im Erdzeitalter Ordovizium (z.B. beim Nautilus).
Bei den höher entwickelten Augen, die echte Bilder wiedergeben können, unterscheidet man zwei Typen: das Einfach- und das Komplex- oder Facettenauge. Einfachaugen ähneln in ihrem Grundbauplan dem Auge des Menschen, wobei sich die Details aber bei den jeweiligen Tiergruppen unterscheiden. Die einfachsten Tiere, die solche Augen besitzen, sind einige Quallenarten.
Die
Orthogenese:
-Begriff der Phylogenetik für eine lange Zeit unverändert beibehaltene Entwicklungsrichtung
-Form einer stammesgeschichtlichen Entwicklung bei einigen Tiergruppen oder auch Organen, die in gerader Linie von einer Ursprungsform bis zu einer höheren Entwicklung verläuft
Polychaeten (Vielborstige Würmer)
Polychaeten (Vielborster) sind eine Klasse der Ringelwürmer (Annelida) oder auch Gliederwürmer. Ringelwürmer werden in zwei Klassen eingeteilt.
Zum einen gibt es die Vielborster (Polychaeta) und zum anderen die
Gürtelwürmer (Clitellata). Die
Vielborster haben ihren Namen von den vielen Borsten, die ihnen bei der
Fortbewegung helfen. Meist leben Vielborster im Meer.
Doch auch in anderen Lebensräumen kann man verschiedene Arten von ihnen antreffen.
Einige sind Jäger und mit großen
gut funktionierenden Augen ausgestattet (zum Teil mit Linse), andere sind z. B.
Aasfresser.
Besonders ungewöhnlich sind die
Röhrenwürmer der Gattung Riftia, die
ihre Nahrung in der Tiefsee erbeuten. So besitzen diese Würmer keine richtigen
Augen, sondern nur lichtunempfindliche Sehzellen. (kann
man lichtunempfindliche Zellen als Sehzellen bezeichnen?)
Doch auch tiefe, becherförmige
Augen sind bei Ringelwürmern häufig. Diese Grubenaugen (siehe auch Abb. 8) sind
eine Weiterentwicklung einfacher lichtempfindliche Sehzellen und kommen bei
mehreren Mehrzelligen Tieren vor, wie auch bei den im Wasser lebenden
Strudelwürmern. Dabei sitzen mehrere Sinneszellen in einer becherartigen
lichtundurchlässigen Vertiefung. Da von ‚hinten’ kein Licht auf die
Lichtempfindlichen Zellen fallen kann, können die Tiere unterscheiden, aus
welcher Richtung das Licht kommt. Ein scharfes Bild der Umgebung lässt sich
damit nicht erreichen, dazu musste in der Evolution erst die Linse entstehen,
mit der sich das Bild scharf stellen lässt.
Zusammenfassend muss festgestellt
werden, dass nur einige wenige spezialisierte Arten der Vielborstigen Würmer
tatsächlich Einzellinsenaugen besitzen.

Abb. 3: Grafik von Polychaeten (Vielborstern), Unter
anderem zu sehen: Blutegel, Regenwurm und Borstenwurm (Quelle: Unbekannt k.A.)

Abb. 4: Borstenwurm (Stamm der
Annelida) (Quelle: Unbekannt2 k.A.)
Cnidaria (Quallen)
Quallen sind überwiegend im
Meer zu finden. Sie gehören fast alle zum Stamm der Nesseltiere (Cnidaria), zu
dem insgesamt bis zu 9.000 Arten gehören
(Postel 2005)
Genauso wie bei den Gastropoden gibt es bei den Quallen solche mit sehr
primitiven und andere mit hoch entwickelten Augen. Die Augen reichen von einem
einfachen Augenfleck, über Becheraugen bis hin zu einem hoch entwickeltem
Linsenauge.
Bei Schirmquallen, Hydroiden und Würfelquallen wechseln aufeinander folgende Generationen ihre Gestalt in unglaublicher Weise. Dabei gehören sie ein und derselben Art an. Zu der im freien Wasser schwebenden Meduse gehört die am Boden, an Algen oder Steinen festsitzende Erscheinungsform, der Polyp (siehe Abb. 5).
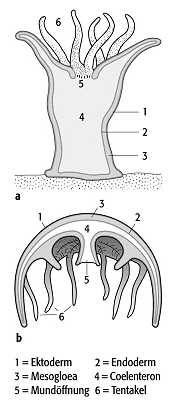
Die Medusen vermehren sich durch
Befruchtung, die Polypen ungeschlechtlich. Im Gegensatz zur Meduse sind die
Polypen nur Millimeter groß. (Postel
2005)
Während Quallen meist nur über
einfache Sinnesorgane verfügen, die das Tier über Oben und Unten sowie Hell und
Dunkel informieren, besitzen Würfelquallen 24 Augen. Acht dieser Augen sind
Linsenaugen mit Hornhaut, Linse, Glaskörper und Netzhaut. Die Linsenaugen
können fokussieren und vermutlich auch Farben erkennen. Ein Rätsel bleibt die
Frage, wie und wo die Qualle die komplexen Bildinformationen verarbeitet, denn
das Tier besitzt zwar ein Netz von Nerven, aber kein übergeordnetes Gehirn.
“Quallen sind nur scheinbar
primitiv. Sie existierten bereits vor 670 Millionen Jahren, als es noch nicht
einmal Fische gab. Dass sie auch heute noch in großer Vielfalt in den
Weltmeeren leben, macht sie zu Erfolgsmodellen der Evolution“ (Cerutti,
2005)
Abb. 5: Morphologie und Orientierung veranschaulicht an je einem Querschnitt von Polyp (a) und Meduse (b); Matin 2001 zitiert in Röser 2001.
Beispielsweise gibt es die Augen von Carybdea (siehe Abb. 6), einer
Würfelqualle aus Australien.
Es sind Linsenaugen mit einer echten Linse und einem Pigmentepithel, das
wie unsere Retina
funktioniert. Daneben gibt es noch weitere Pigmentbecherocellen, also Augen
ohne Linse.
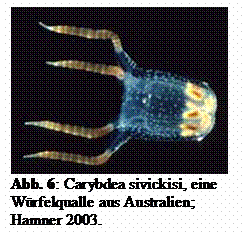
“Wozu brauchen die Nesseltiere Augen? Alle Nesseltiere haben eine
Empfindlichkeit für das Licht, auch ohne dass eigene Augen ausgebildet sind.
Ansätze zu den Linsenaugen finden wir bei vielen Medusen von Hydrozoen und
Cubozoen (Wüfelquallen).“ (Holstein 2006)
Wozu braucht Carybdea die Linsenaugen: Letztlich ist dies nicht bekannt;
aber Carybdea besitzt ein bemerkenswertes Paarungsverhalten: Das Männchen
übergibt dem Weibchen sein Spermienpaket; ein richtiges Paarungsspiel.
Prof. Dr. Thomas Holstein von der Universität in Heidelberg glaubt, dass
die Augen bei diesem Verhalten ihre Aufgaben erfüllen.
Ferner spricht er noch von einer anderen Erklärung: sie werden zum Beutefang gebraucht: das ist
aber laut ihm eher unwahrscheinlich, da alle Medusen (Quallen) und auch die
Polypen, ohne Augen mit ihren Tentakeln, die mit giftigen Nesselzellen besetzt
sind, ihre Beute fangen.
Die Gene die, die Augenentwicklung steuern, sind von den Quallen bis zum
Menschen sehr ähnlich. (Holstein 2006).
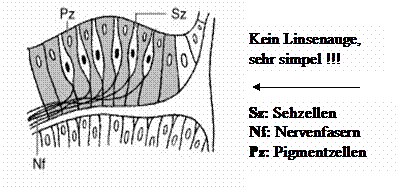
Abb. 7: Flachauge (Plattenauge) einer Qualle,
im Gegensatz zu den weitaus besseren Linsenaugen sind Flachaugen bei Quellen
wesentlich häufiger zu finden, (Bildquelle: Lexikon der Neurowissenschaften,
k.A).
Gastropoden (Schnecken)
Zu Gastropoden sagt man im allgemeinen Sprachgebrauch auch einfach Schnecken. Genauso wie die Kopffüßer (Cephalopoden) gehören sie zu den Weichtieren, den Mollusken.
Schnecken sind die artenreichste und einzige Klasse der Weichtiere, die auch landlebende Formen entwickelt hat. Sie sind auf verschiedenen Böden anzutreffen, aber keine typischen Bodentiere.
Sie sind eine Untergruppe der Wirbellosen, insgesamt gibt es etwa 110 000 verschiedene Arten.
Die Mehrzahl der Gastropoden hat ein Paar Augen im Kopf, entweder an der Spitze der Tentakeln (Fühler) oder in der Nähe des Celebralganglions( das Gehirn der Schnecken). Die Augen variieren jedoch je nach Art beträchtlich in Größe, Struktur und Anzahl der Rezeptoren. Dieses hat entscheidenden Einfluss auf die optischen Fähigkeiten der jeweiligen Schnecke. Grob gesehen lassen sich zwei Typen von Augen unterscheiden:
1: Augen ohne Linse: einfache Grubenaugen (siehe Abb. 8) und Lochkameraaugen
![]() 2: Die hochentwickelten
Linsenaugen (die Beschaffenheit der Linse ist auch noch sehr unterschiedlich) (siehe z.B. Abb. 9)
2: Die hochentwickelten
Linsenaugen (die Beschaffenheit der Linse ist auch noch sehr unterschiedlich) (siehe z.B. Abb. 9)
Die Lisenaugen der Gastropoden sind everse Augen (d.h. sie haben eine everse Retina), die embryonal aus einer Einstülpung der Körperaußenwand entstehen. Die Lichtsinneszellen zeigen ins Augeninnere, und sind daher, im Gegensatz zu denen der Wirbeltiere(welche eine inverse Retina besitzen), dem Lichteinfall zugewandt.
Die Augen der Gastropoden(wenn sie ein Linsenauge besitzen) sind extrem lichtempfindlich, die Schwelle liegt teilweise unter 6´10-11 Watt/sec. Zum Vergleich das menschliche Auge muss sich bereits einige Minuten an die Dunkelheit gewöhnt haben um eine solche Lichtquelle überhaupt als einen schwach leuchtenden Punkt zu erkennen. Die hohe Lichtempfindlichkeit wird auf eine hohe Anzahl von Stäbchen zurückgeführt.
Die bestentwickelten Augen der Gastropoden verfügen über härte sphärische Linsen, wie sie auch bei den Cephalopoden, den Fischen und überhaupt bei allen Meeresbewohnern vorkommen. Dieses stellt eine Anpassung an die besonderen Anforderungen des maritimen Lebensraums dar.
Im Vergleich:

Abb. 8: Grubenauge
Sz: Sehzellen, Pz: Pigmentzellen, Nf: Nervenfasern
(Lexikon der Neurowissenschaft, k.A.)
Cephalopoden (Kopffüßern)
Die biologische Gattung der sog. Cephalopoden (Kopffüßer) – beispielsweise Kalmare (Tintenfische) oder auch Kraken (Octopuse) – gehört gemeinsam mit Muscheln und Schnecken zu den wirbellosen Mollusken (Weichtieren).
Der gemeinsame Vorfahre aller Kalmare und Kraken ist der Ur-Tintenfisch „Nautilus“, der vor ca. 500 Millionen Jahren entstand.
Aus
diesem Ur-Tintenfisch entwickelten sich im Laufe der Zeit verschiedene Arten
von Cephalopoden (Kopffüßern), die
man in zwei Unterklassen unterteilt: Zweikiemer und Vierkiemer. Dabei gibt es
sowohl frei schwimmende als auch am Boden des Meeres lebende Arten. Insgesamt
sind der Wissenschaft etwa 650 verschiedene Arten bekannt. (Schäfer & Weiß
1999)
Cephalopoden gehören zu
den intelligentesten wirbellosen Tieren und sind beispielsweise intelligenter
als Reptilien. Sie kommen in allen Weltmeeren vor, sowohl in der Hoch- als auch
in der Tiefsee.
(Wikipedia
k.A.)
Da die meisten Cephalopoden auf dem Meeresboden in unterseeischen Felshöhlen oder in Korallenriffen leben, sind sie auf sehr lichtempfindliche Sehzellen angewiesen. Tintenfische, zum Beispiel, können ihre düstere Umgebung aufgrund ihrer ausgeprägten, lichtempfindlichen Augen sehr gut „sehen“. Andere Cephalopoden setzten außerdem Leuchtorgane ein (betreiben Bioluminiszenz); beispielsweise verwirren einige Tintenfische auf der Flucht ihre Angreifer durch eine Wolke aus leuchtenden Bakterien.
Bei
den Augen der Cephalopoden handelt es
sich um hoch leistungsfähige Linsenaugen, die ähnlich den Linsenaugen
von Wirbeltieren aufgebaut sind. So verfügen sie beispielsweise ebenfalls über Iris,
Pupille und Linse (siehe Abb. 10);
jedoch gibt es auch deutliche Unterschiede zu den Augen der Wirbeltiere:
- die Lichtsinneszellen der Netzhaut (Retina) sind bei Cephalopoden dem Lichteinfall zugewandt (→ everses Auge); das Licht muss also nicht wie bei Wirbeltieren zuerst mehrere Zellschichten durchdringen, bevor es auf die Netzhaut trifft (→ inverses Auge)
- das Auge eines Cephalopoden entsteht (anders als bei Wirbeltieren) durch eine Einfaltung der Epidermis, der embryonalen Außenhaut; dann wird dieser „Augenbecher“ vom Gehirn mit Nerven versorgt, weshalb die Sinneszellen nach außen zeigen
- ganz allgemein sind die Linsenaugen von wirbellosen Tieren (Invertebraten), zu denen ja auch die Cephalopoden gehören, phylogenetisch unabhängig von den Linsenaugen der Wirbeltiere entstanden; trotz gleicher Funktionsweise
(Nordsiek 2005)
|
|
Abb. 10: Querschnitt durch
das Linsenauge eines Kopffüßers, in der Mitte rot
eingefärbt sind die Linse und der Glaskörper; das Licht tritt von rechts ein
und trifft auf die gebogene Netzhaut rechts, als rotes Areal ist links der
Sehnerv zu erkennen (Parmentier k.A.) |
Heute hat der Kraken, ein Cephalopode,
die am weitesten entwickelten Sehsinnesorgane aller wirbellosen Tiere (siehe
Abb. 11 und Abb. 12).
Der Krake ist daher der am besten sehende Kopffüßer und gilt
gleichzeitig als der intelligenteste.
Seine Linsenaugen können einem Vergleich mit dem Auge eines Wirbeltieres durchaus standhalten. (Nordsiek 2005)
|
|
Abb. 11: Linkes Auge eines Kraken, auffällig ist die typische quer stehende Form der Pupille (Stampfel und andere 2005) |
|
|
Abb. 12: Linkes Auge einer
anderen Krakenart
(Patzner, k.A.) |
Literaturverzeichnis:
Boukricha, Hana, Finke, Andrea und Bongenberg, Michael:
Seminar Unterwasserbildverarbeitung, SoSe 2002, „Die Augen der Mollusken“,
Klasse Gastropoda, (2) Augen, 2.1 – 2.4
Cerutti, Herbert: NZZ Folio 11/05, „Von Tieren,
Tödliches Feuer im Wasser“, 2005, Online:
http://www-x.nzz.ch/folio/archiv/2005/11/articles/tiere.html, zuletzt
aufgerufen am 17.03.06.
Chefredakteur: Zinken, Richard, Copyright:
Spektrum Akademischer Verlag, Lexikon der Neurowissenschaft, Heidelberg,
k.A., Online: http://www.wissenschaft-online.de,
Lexikon der Neurowissenschaft, Stichwort: Auge, zuletzt aufgerufen am 17.03.06
Czihak, Langer und Ziegler: "Biologie"
(Springer-Verlag), "Sinne, Nerven, Hormone" (Cornelsen-Velhagen &
Clasing); gekürzt und ergänzt von Rudolf Öller,
Online: http://www.vobs.at/bio/physiologie/a-augen.htm,
zuletzt aufgerufen am 17.03.06
DocCheck: Flexikon - Ontogenese -
Dockcheck Medical Services GMBH, Köln, 2002,
Online: http://flexicon.doccheck.com/Ontogenese,
zuletzt aufgerufen am: 17.03.06.
Duden, das Fremdwörterbuch, Dudenverlag (1994)
Gershwin, Lisa-Ann: „Cubozoa: Some of my favorite
species”, Australien, 1998-2002, Online:
http://www.medusozoa.com/cubo_pics.html, zuletzt aktualisiert: 11.03.2003
21:43, zuletzt aufgerufen: 17.03.06.
Holstein, Thomas: das Linsenauge der Carybdea – Inst.
Zoologie, Uni-Heidelberg, persönliche Mitteilung, 2006
Meindl, Wolfgang, 2006: Online:http://www.wissen.swr.de/warum_chemie/farbe/themenseiten/t4/s2.html,
zuletzt aufgerufen 17.03.2006
Lubjuhn, Thomas: Gliederung der Vorlesung -
Sinnesorgane der Tiere - Eigenverlag der Universität Münster, Münster, 2005; Online:
http://www.uni-muenster.de/Biologie/Main/aktuell/Sinnesorgane%20-%20Tiere.pdf,
zuletzt aufgerufen: 06.03.2006
Martin, C. (Hrsg.): Lexikon der Geowissenschaften.
CD-ROM. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg, 2001.
Nordsieck, Robert, Wien, Österreich: 1999
– 2005,
Online: http://www.weichtiere.at/Schnecken/morphologie/versuche.html,
zuletzt aufgerufen am 17.03.06
Nordsiek, Robert: Augen bei Weichtieren, Wien,
1999-2005, Online: http://www.weichtiere.at/Weichtiere/augen.html
und Online:
http://www.weichtiere.at, zuletzt aufgerufen: 17.03.2006
Parmentier, Jan, Niederlande, k.A. Online:
http://www.euronet.nl/users//janpar, zuletzt aufgerufen am 17/03/06
Parmentier, Jan: Linsenauge
eines Kopffüßers (Alloteuthis), k.A.,
Online: http://www.weichtiere.at/Weichtiere/augen.html,
zuletzt aufgerufen: 17.03.06
Patzner, Robert,
Universität Salzburg: Auge eines Kraken, k.A., Online: http://www.weichtiere.at/Kopffuesser/octopus.html,
zuletzt aufgerufen: 17.03.2006.
PD Dr. Hellberg-Rode, Gesine -
08.10.02: Projekt Hypersoil, Münster, Online:
http://hypersoil.uni-muenster.de/0/07/04/03.htm, zuletzt aufgerufen am 17/03/06
Postel, Lutz: „Filigrane Wunderwerke oder glibberiger
Matsch: Quallen - Vorkommen und Gefährdung“, Leibniz-Institut für
Ostseeforschung Warnemünde, 2005, Online:
http://www.io-warnemuende.de/forum/splitter05/pos.html, zuletzt aktualisiert am
21/07/2005, zuletzt aufgerufen am 17/03/06.
Röser, Georg: Tabulate Korallen und ihre Rolle im
Ostseebecken.- Geologisch-Paläontologisches Institut, Universität Heidelberg,
Arbeitsexkursion Ostseebecken (Småland-Öland-Gotland, Schweden), 2001, Online:
http://palaeo.uni-hd.de/Thema6.htm, zuletzt abgerufen: 07/03/2006.
Schäfer, Peter und Weiß,
Hennes: Kopffüßler (Cephalopoden) - Ein Projekt des BIO-LKs 1998/99 der
Alfred-Delp-Schule-Dieburg, 1999, Online:
http://www.paed-quest.de/Riff_Tiefsee_Mangroven_neu/tiefsee/content/weich03.html,
zuletzt aufgerufen: 26.02.06.
Stampfel, Sabine; Amann, Aurelia & Unger, Yvonne:
Tierlexikon für Kinder – OLI’s Wilde Welt, Südwestrundfunk, 2005, Online: http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/index.php?tid=47&reiter=verhalten
Unbekannt:
www.google.de/polychaeten, www.senkenberg.de, k.A., zuletzt
aufgerufen: 06.03.06
Unbekannt2:
http://www.biologie.uni-hamburg.de/zim/niedere2/bilder/poychaet.jpg,
zuletzt aufgerufen: 06.03.06
Wikipedia – Die Freie
Enzyklopädie: Kopffüßer, k.A., Online: http://de.wikipedia.org/wiki/Cephalopoden,
zuletzt aufgerufen: 26.02.06.
Wikipedia-
Die freie Enzyklopädie: http://www.wikipedia.org/wiki/Polychaeten,
Autor: k.A., Zum letzten Mal aufgerufen:6.3.06
http://www.datz.de ,,Autoren: Peter Wirtz und Peter
Nahke , Ausgabe: 10/2004 , Zum letzten Mal aufgerufen: 6.3.06


